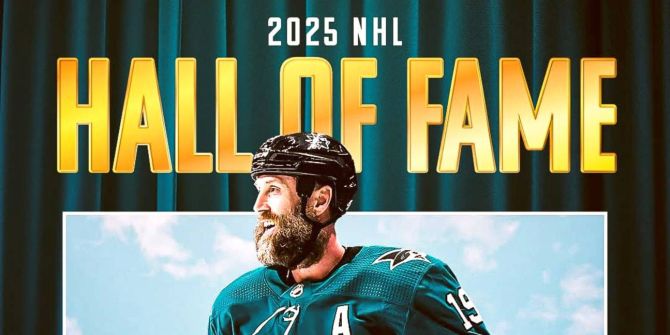«Blueliner Berger»: Wie die Wettdrohungen zum Problem werden

Wettdrohungen werden auch im Eishockey zum Problem. Der Milliardenmarkt der Sportwetten bringt zunehmend unappetitliche Auswüchse mit sich.

Im August gab Brady Tkachuk ESPN ein bemerkenswertes Interview. Der Captain der Ottawa Senators sagte, dass er seinen Venmo-Account – vergleichbar mit der Schweizer Bezahlungsapp Twint – ändern musste, weil zornige Glücksritter ihm ständig Zahlungsaufforderungen für verlorene Sportwetten schickten.
Anders als in der Schweiz kann man in Nordamerika auf fast alle Facetten einer Eishockeypartie wetten, etwa wie viele Skorerpunkte ein Spieler produziert. Oder wie viele Torschüsse er abgibt. Teilweise sogar auf die Anzahl Checks und die geblockten Schüsse.

Es kann also theoretisch sein, dass Tkachuk für Ottawa bei einem souveränen Sieg zwei Tore erzielt. Und online dann trotzdem ungefilterten Zorn abkriegt, weil er nicht oft genug aufs Tor geschossen hat, um eine Wette zu gewinnen.
Schon länger ist bekannt, dass vor allem Tennisspieler auf den Sozialen Medien mit widerwärtigen Nachrichten frustrierter Spielsüchtiger konfrontiert sind; die Palette reicht von Morddrohungen bis zu den geschmacklosesten Hassnachrichten.
Der Argentinier Marco Trungelliti (ATP Nr. 183) sagte der NZZ im Juli in Gstaad: «Ich könnte jetzt mein Handy hervorholen und hätte bestimmt zehn Instagram-Nachrichten, in denen mir, meiner Frau oder meinem Sohn der Tod gewünscht wird. Und das nach einem gewonnenen Match.»
Tennisprofis sind als Einzelsportler besonders anfällig für diese Art von Abusus. Aber längst trifft es auch Fussballer, Basketballspieler und eben Eishockeyprofis.

In einer Umfrage von «The Athletic» gab im November fast ein Drittel der befragten NHL-Profis an, regelmässig mit Onlinehass konfrontiert zu werden.
Besserung ist kaum in Sicht, der Markt für Sportwetten ist in den letzten Jahren explodiert. Alleine in den USA wurden 2024 fast 150 Milliarden Dollar umgesetzt – es ist das direkte Resultat einer umfassenden staatlichen Legalisierung.
Profiteure gibt es wenig, eigentlich nur die Anbieter. Die Zahl der Spielsüchtigen ist rapide angestiegen. Und selbst als neutraler, unbescholtener Zuschauer wird man bei Liveübertragungen mit Wettwerbung zugemüllt.
Mehr noch: Die Live-Quoten werden von den übertragenden TV-Stationen direkt eingeblendet, es gibt als Konsument wahrlich kein Entkommen mehr.

In der Schweiz ist die Lage weniger dramatisch. Aber auch beim staatlichen Monopolisten sporttip steigen die Erträge jährlich: 2024 erzielte das Mutterunternehmen Swisslos mit Sportwetten einen Reingewinn von 122 Millionen Franken.
Es ist viel Geld und fliesst teilweise über Sportfördergelder in den Nachwuchs- und Breitensport.
Unterstützt wurden zuletzt etwa die Erneuerungen der Kunsteisbahnen in Dübendorf und Küsnacht, es ist unstrittig, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird.
Global gesehen aber sind die Schatten längst grösser als ein potenzieller, kurzfristiger Gewinn.
Die französische Tennisspielerin Carolina Garcia sagte kürzlich: «Ich kriege hunderte von üblen Nachrichten. Leute sagen mir, sie hoffen, dass meine Mutter bald sterbe. Das ist einfach nicht okay.» Eigentlich ist diesem Schlusssatz nichts hinzuzufügen.
Über den Autor Nicola Berger
Nicola Berger schreibt seit mehr als 15 Jahren über das Schweizer Eishockey – er tat das lange für die «Luzerner Zeitung». Und auch für Produkte, die es betrüblicherweise längst nicht mehr gibt: «The Hockeyweek», «Eishockey-Stars», «Top Hockey».
Seit 2013 ist er Reporter bei der NZZ und hat eine ausgeprägte Schwäche für Aussenseiter sowie aus der Zeit gefallene Stadien und Persönlichkeiten. Ein Königreich für ein Comeback von Claudio Neff.